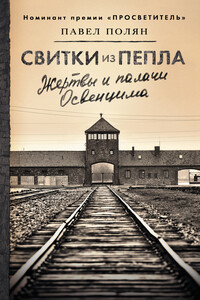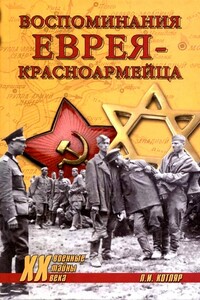Еврейские судьбы: Двенадцать портретов на фоне еврейской иммиграции во Фрайбург | страница 46
Lev Davydovitsch kam schon in Leningrad, im Jahr 1928, zur Welt (sein älterer Bruder wurde drei Jahre früher noch in Weißrussland geboren). Folgendes ist aber dem jüngeren Bruder in Erinnerung geblieben: In Petersburg gab es damals viele Chinesen! So viele, dass man sie überall sah! Sie betrieben Stände, wo sie «Brauning»-Spielzeugpistolen und andere Spielsachen verkauften. Und im Jahr 1932 oder 1933 waren sie alle auf einmal – buchstäblich von einer Stunde auf die andere – verschwunden. Es war erstaunlich: Wie und wohin?
Dann kamen die Polen. In dem Haus an der Straße Ligovski-Prospekt, in dem die Familie Peskin wohnte, gab es sehr viele Polen. 1936 begann ihre Verfolgung und auch sie verschwanden nach und nach.
Wer sollte der Nächste sein? Nach einem mitgehörten Gespräch der Eltern, konnte jeder der Nächste sein. Der Hausmeister teilte dem Vater aufgrund ihrer Freundschaft mit, dass ihm befohlen wurde, «Volksfeinde» ausfindig zu machen. Alles weitere sei nicht mehr seine Sache.
Alle Verhaftungen wurden nachts durchgeführt und jeden Abend parkte der «Schwarze Rabe», die Limousine des NKWD, vor dem Haus. Die Familie Peskin traf es damals nicht.
Leva kam mit 8 Jahren in die erste Klasse der 8. Leningrader Schule. Er schloss sie nach fünf Klassen ab und folgendes blieb ihm ein Leben lang in Erinnerung.
Noch in der ersten Klasse bekam er von einem der Jungs zu hören: «Žid, der Jude, verkaufte Würmer». Leva brach in Tränen aus und dann kam der Geographielehrer zu ihm und fragte was los sei, warum er weinte. Nach dem er das mit den «Würmern» hörte, grinste er nur kurz und ging wieder zurück ohne was zu sagen. Warum tat er nichts?
Dennoch gab es keinen ständigen oder zügellosen Antisemitismus in der Schule. Und während der Blockade erst recht nicht. In der Klasse gab außer Leva keine Juden. Während der Blockade konnte man dann sowieso kaum mehr an die Schule zu denken. In der ersten Zeit kamen die Schüler noch aus Gewohnheit, später dann gar nicht mehr.
Blockade
Als der Krieg ausbrach, war die Familie in der Stadt. Am 20. Juni gingen sie ins Kino «Molot» an der Razyezzhaya Straße. Es lief eine Wochenschau mit dem Titel «Wenn der Krieg morgen kommt», man ahnte also schon was und es lag in der Luft.
Dann begannen die Bombardierungen und der Beschuss durch Artillerie. Als die Deutschen näher rückten, nahmen sie die Stadt mit Langstreckenkanonen unter Beschuss, was weniger vorhersehbar und damit schlimmer war, als die Bomben. Bei den Bombardierungen warfen die Deutschen viele Brandbomben, damit so viel wie möglich niederbrennt. Die Bomben waren auf Magnesiumbasis gebaut, wogen bis zu zwei Kilogramm und explodierten nicht, sondern setzten alles rund herum in Brand. Sobald eine Bombardierung begann rannten die Jungs furchtlos auf den Dachboden, wo die Fässer mit Sand standen. Über der Stadt waren sehr viele Aerostate, um Bombardierungen zu verhindern. Viel halfen die aber nicht, die Deutschen zündeten sie an oder schossen sie aus ihren Flugzeugen ab.